Beitrag
5 Min.

24. Oktober 2025
Tagebau Bockwitz: Was bringt die Zeit nach der Kohle?
Wenige Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung wurde der Tagebau Bockwitz bei Leipzig 1992/93 geschlossen. Das abrupte Ende der Kohleindustrie brachte die Region an einen Wendepunkt. Landschaften und das Zusammenleben der Menschen änderten sich stark - zum Guten oder zum Schlechten?
Hell scheint die Sonne an diesem Samstagnachmittag auf den Bockwitzer See bei Borna. Ihre Strahlen tanzen auf der Wasseroberfläche, spiegeln sich und funkeln. Wir laufen in Gruppe am Ufer des Sees entlang, alle sind hingerissen vom Naturschauspiel, das sich bei bestem Wetter vor uns zeigt. Rings um den See wachsen Bäume, teilweise so dicht, dass sie einen ganzen Wald ergeben. Vor 30 Jahren sah es hier noch ganz anders aus.
Die Kleinstadt Borna liegt circa 30 Kilometer südlich von Leipzig und war jahrzehntelang eng mit dem Abbau von Braunkohle verbunden. Die Region hatte zwei Tagebaue: Borna-Ost, der von 1960 bis 1985 betrieben wurde, und den Tagebau Bockwitz, der 1982 die Förderung begann und für den der Ort Bockwitz 1988 geräumt werden musste.
Wenige von der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft (kurzMIBRAG) betriebene Tagebaue, wie der Tagebau Vereinigtes Schleenhain, sind weiterhin aktiv und fördern noch Kohle für die Kraftwerke Schkopau und Lippendorf. Der Bergbau ist also noch nicht gänzlich aus der Landschaft verschwunden– und erst recht nicht aus den Köpfen der Menschen, die sich noch immer mit der Zeit des Tagebaus beschäftigen.
Das Leibniz-Lab ist nach Borna gekommen, um mit den Menschen über die Veränderungen zu sprechen, die das Kohle-Aus mit sich brachte – sowohl die positiven, als auch die negativen. Es soll um bergbaubedingte Umsiedlungen und Naturschutz gehen, um die Energiewirtschaft in der boomenden Region Leipzig, um Tourismus und das Erinnern an eine prägende Zeit.
Rund 50 Personen sind unserer Einladung gefolgt. Wir treffen uns am Samstagmorgen am Bahnhof in Borna. Von hier fährt der Bus ab, der uns auf das Gelände bringt, um das es heute geht. Später, am Nachmittag, wollen wir bei Kaffee und Kuchen mit den Teilnehmenden ins Gespräch kommen.

Kohle-Aus für den Tagebau Bockwitz: Ein zweischneidiges Schwert
Mit der deutschen Vereinigung 1989/90 sank der Braunkohlebedarf drastisch. Borna-Ost und Bockwitz gehörten zu den ersten Tagebauen, die nach der Wende geschlossen wurden, nämlich bereits 1992/1993. Was für die Region den Anfang einer wirtschaftlichen Abwärtsspirale darstellte, war für die Umwelt ein Segen. In den nächsten Jahren entwickelte sich hier ein Naturparadies.
Das Restloch des Tagebaus wurde von 1993 bis 2004 mit Wasser gefüllt und nach der Ortschaft benannt, die hier dem Tagebau hatte weichen müssen: Bockwitzer See. Seit 2001 ist das Areal als Naturschutzgebiet gesichert, und zählt mit einer Gesamtfläche von 565 Hektar zu den größten Schutzflächen in Sachsen.
Die Ökologische Station Borna-Birkenhain unterstützt durch gezielte Aktionen im Naturschutzgebiet die Pflanzen- und Tiervielfalt. Von Orchideen bis Uferschwalben sind viele verschiedene Arten am Bockwitzer See zu finden.
Bei der Exkursion wird uns der Wandel der Landschaft bewusst – die schroffen Tagebaulandschaften sind nun einem Naturraum gewichen. Christin Berndt von der Ökostation Birkenhain-Borna führt uns durch das Gelände und weist auf viele, bis heute sichtbare Spuren des Tagebaus hin. Mit Hilfe von Abbildungen und Karten erklärt sie, wie die Grubenarbeit in Borna und Umgebung aussahen. Unter den Teilnehmenden, darunter ehemalige Mitarbeitende der nahen gelegenen Kraftwerke, können einige zusätzliche Informationen und eigene Erfahrungen beisteuern.

„Ich konnte meine Heimat riechen“
Rund zwei Stunden später, Geschirrklappern, Kaffeegeruch und süße Kuchenstreusel. Wir sind im Goldenen Stern, dem Bürgerhaus von Borna, angekommen. Hier wärmen wir uns nun mit Kaffee und Kuchen auf. Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch gekommen, über die Exkursion und ihre Erinnerungen an die (Nach-)Wendezeit.
Rege diskutieren die Gäste darüber, wie das teilweise negativ vorherrschende Außenbild der Kohleregionen als „schmutzige Industrieregion“ verbessert werden könnte. Vor allem die neu geschaffene Seenlandschaft, die Rad- und Wassersportbegeisterte anlockt, könnte das Image positiv verändern.
An einigen Tischen dominieren Erinnerungen an das Tagebauleben, die den Stolz auf die Energiegewinnung spiegeln. Zugleich sind sich alle Anwesenden bewusst, wie schlecht der Kohleabbau für die Umwelt und die Gesundheit waren. „Ich konnte meine Heimat riechen“, fasst eine Person den unverwechselbaren Geruch der Kraftwerke und Fabriken zusammen, der die ganze Region prägte. Es sei kein guter Geruch gewesen und doch verbindet sie damit positive Erinnerungen und Gefühle an ihre Heimat.
Auf die Frage, was sich am meisten veränderten hätte, antworten einige Gäste: „die Menschen“. In der lokalen Bevölkerung fehle mittlerweile der Zusammenhalt, stattdessen habe sich eine gewisse Distanziertheit entwickelt. Später in der Diskussion wurden diese Einschätzungen relativiert bzw. mit Verständnis betrachtet. Eine Person sagt, dass man selbst heute eher Grenzen ziehe und weniger für andere tut; ihr Gegenüber entgegnet, dass in ihrer Wohnanlage der Zusammenhalt gerade unter älteren Menschen schon noch da sei.

Tagebau Bockwitz und mitteldeutsche Industrieregion: An das verlorene Erbe erinnern
Anfang der 1990er verschwanden viele Gebäude, Denkmäler und Orte, die für die Zeit der Braunkohle standen. Mit dem Ende des Tagebaus schlossen auch die verwandten Industrien mit ihren riesigen Anlagen ihre Tore und wurden abgebaut. Viele Anwohner:innen, deren Biographien von diesen Orten geprägt wurden, wünschen sich jedoch, dass diese Zeit dokumentiert und in Schriftstücken, Objekten und Erzählungen bewahrt wird.
Zu diesem Zweck ist 2015 der Verein DokMitt entstanden, der Förderverein zum Aufbau des Dokumentationszentrums IndustrieKulturlandschaft Mitteldeutschland e.V., der zielstrebig sammelt, bewahrt und erschließt, was es zur Industrie- und Bergbaugeschichte im Mitteldeutschen Revier gibt. Merve Lühr, Leiterin der DOKMitt Geschäftsstelle in Borna berichtet von den regelmäßigen Bergmannstammtischen und dem geplanten Dokumentationszentrum zur Regional- und Wirtschaftsgeschichte Sachsens, in das DOKMitt mit seinem Büro und Sammlung im kommenden Jahr einziehen wird.
Zudem befassen sich zwei in Leipzig aufgewachsene Wissenschaftlerinnen in ihrer Forschung mit der Region. Franziska Görmar und Christine Richter präsentierten in Borna ihre Erkenntnisse, um den Teilnehmer:innen ein besseres Verständnis für die Transformationsprozesse in ihrer Region zu geben. Franziska Görmar vom Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) erforscht, wie sich das Narrativ der Region durch das Kohle-Aus veränderte.
Die Forscherin Christine Richter vom Frauenhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (Frauenhofer ISI) wiederum hat Interviews mit Menschen geführt, die vom Strukturwandel betroffen sind, um die statistischen Daten um wichtige gesellschaftliche Aspekte zu ergänzen, die sonst schwer messbar sind. Dafür sprach sie mit Personen aus Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft sowie Kunst und Kultur.
Erneuerbare Energien weisen die Zukunft
Mit dem Moving Lab wollen wir aber nicht nur in Erinnerungen schwelgen, sondern auch in die Zukunft schauen. Wie geht es weiter in der Region Borna? In den Gesprächen wurde nach Erfahrungen von Bürgerbeteiligung gefragt. Einige berichteten, dass diese mal mehr, mal weniger gut liefen. Sie waren sich am Samstag einig, dass bei solchen Planungsprozessen stets Fachleute, Genehmigungsbehörden und davon betroffene Menschen involviert sein sollten und zwar auf Augenhöhe.
In den Erzählrunden diskutierten die Teilnehmer:innen auch über die Pro- und Contra Argumente von Windrädern, Solaranlagen und Wasserstoffenergie. In den letzten Jahren sind rund um Borna große Flächen zur Erzeugung erneuerbarer Energien z.B. durch Photovoltaikanlangen entstanden. Mit dem Energiepark Witznitz ging im Juli 2024 der größte Solarpark Deutschlands in Betrieb, so der MDR. Rund 1,1 Millionen Solarmodule wurden dafür aufgestellt. Weitere 160 Hektar sollen laut Leipziger Volkszeitung mit Photovoltaikanlagen bebaut werden. Das Thema Energie verschwindet also nicht wie die Braunkohle aus der Region, sondern bleibt Teil der wirtschaftlichen und landschaftlichen Entwicklung.

Verlusterfahrungen und Skepsis treffen auf Naturerleben und Optimismus
Das Moving Lab in Borna hat bei allen Teilnehmenden ein Bewusstsein für die sichtbaren wie nicht sichtbaren Umbrüche der Region geschaffen. Die Braunkohlezeit und die seitdem beschrittenen Wege – von Photovoltaikanlangen über Wassersport- und Radtourismus – sind vielfältig und intensiv miteinander verwoben. Gefühle von „Abgehängtsein“ und einem negativen Image der Region wurden artikuliert. Spürbar war aber auch eine Zuversicht unter den Menschen, die sich in individuellem Tatendrang und gemeinschaftlichem Gestaltungswillen ausdrückte. Viele Menschen, das zeigte das Lab, interessierten sich für tiefergehenden Erkenntnisse zur Geschichte und Gegenwart ihrer Heimat und waren bereit, ihre individuellen Geschichten beizusteuern.
Das Moving Lab des Leibniz-Lab „Umbrüche und Transformationen“ fand am 13. September 2025 von 10 bis 16:30 Uhr am Bockwitzer See und im Goldenen Stern in Borna statt und war eine Kooperationsveranstaltung von DOKMitt e.V., Leibniz-Institut für Länderkunde, Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI / Standort Leipzig und Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Borna.
Über diesen Artikel
Lesen Sie auch

50% Urban – eine Woche Sommerschule durch Ostdeutschland
Ein Text zur Sommerschule: Transformation in Motion.

(Wieder-)Vereinigung, Wende, Umbruch – Wie sprechen wir über die Ereignisse von 1989/90?
Für die Ereignisse ab dem Herbst 1989 gibt es viele Begriffe, die kontrovers diskutiert wurden. Wie konnte sich der Wendebegriff durchsetzen?
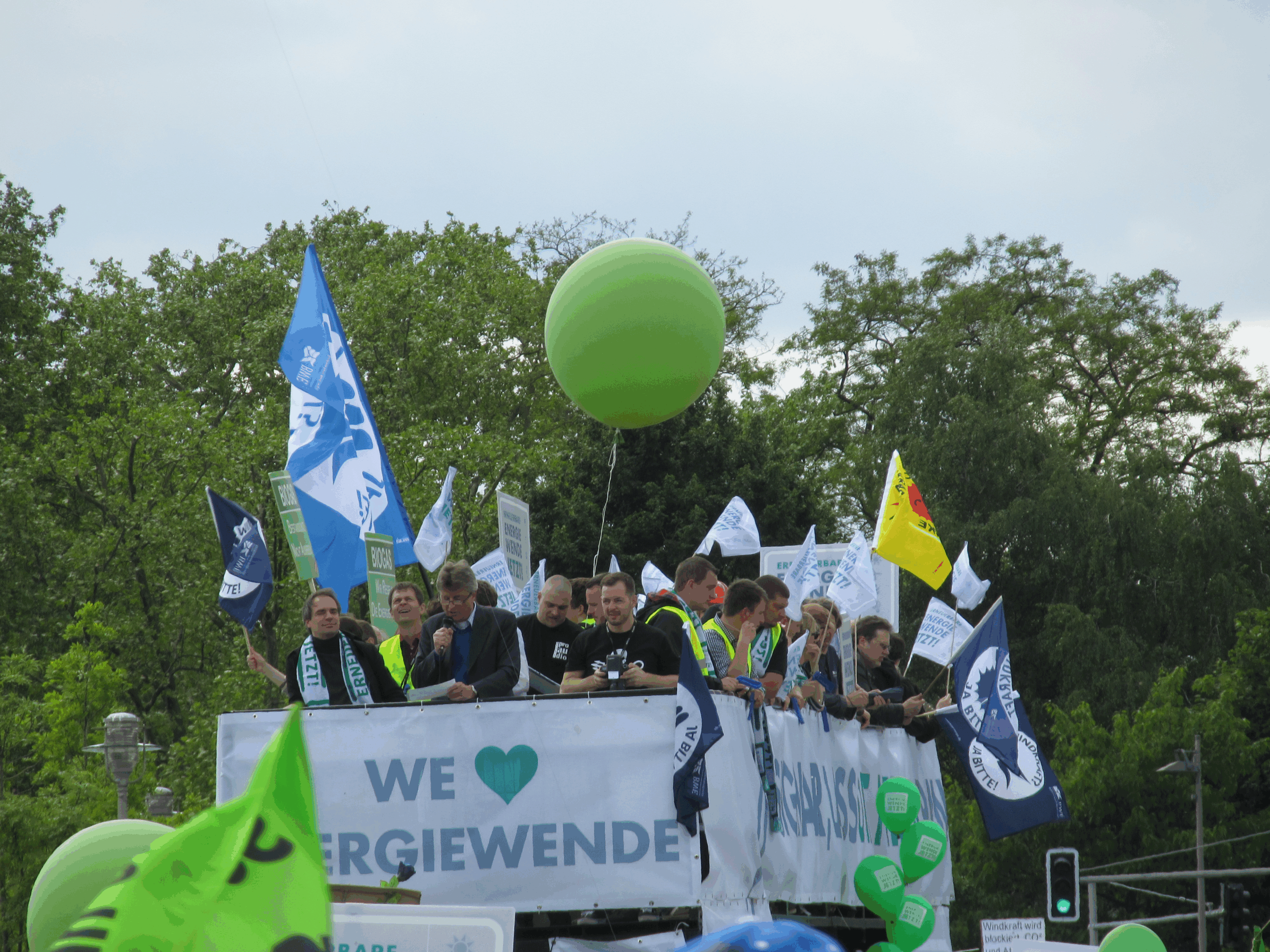
Älter als man glaubt – Eine kurze Geschichte der deutschen Energiewende
Die Energiewende ist älter als viele denken. Seit den 70ern gibt es Ideen, Bewegungen, Rückschläge in Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik.

